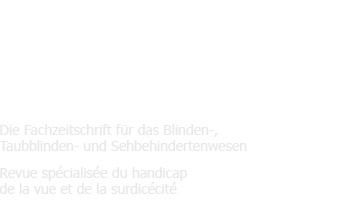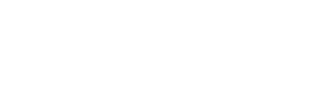„Allen voran steht die Einstellung“
Inklusion von Schülerinnen und Schülern mit Sehbehinderung
Von Peter Rodney
Inklusion von (seh)behinderten Schülerinnen und Schülern bewegt sich zwischen zwei Polen: Auf der einen Seite steht die pädagogischer Ideologie – der Wunsch oder die Utopie, dass alle Schülerinnen und Schüler, unabhängig von ihren Fähigkeiten und Einschränkungen, miteinander lernen dürfen und können – auf der anderen Seite die soziale Realität.

Damit Inklusion gelingen kann, braucht die ganze Schulklasse Empathie und Bindungsfä-higkeit.
Bild: luxuz, photocase.com
Im Idealfall wird eine Balance zwischen diesen Polen eingehalten. In der Praxis sieht es jedoch anders aus: Inklusion wird eingeführt, ohne die sozialen und individuellen Voraussetzungen der betreffenden Personen zu berücksichtigen. Das kann verheerende Folgen haben. Nicht nur, dass die betroffenen Schülerinnen und Schüler stark überfordert sein können – im schlimmsten Fall werden sie psychisch krank oder sozial ausgegrenzt.
Was braucht es, damit Inklusion erfolgreich ist? Dazu müssen wir uns die Frage stellen, wie die Gesellschaft grundsätzlich mit Menschen umgeht, die anders sind. Und wie das einzelne Individuum die Anforderungen der Gesellschaft erfüllen kann.
Die Einstellung ist dabei der zentrale Faktor: Einstellungen sind erlernte Muster, welche wie eine „Vorausbereitschaft“ wirken. Sie erklären menschliches Verhalten und sagen zukünftiges Handeln voraus. Einstellungen sind funktional, so dass wir nicht für jede neue Situation unsere Verhaltensweisen neu überdenken müssen. Einstellungen drücken unsere Werte in zentralen Lebensbereichen aus und formen Wissen und Erfahrungen.
Einstellungen bestehen aus drei Komponenten: einer kognitiven – sie bestimmt, wie wir die Welt sehen, einer emotionalen – sie bestimmt, ob wir Werte oder Überzeugungen positiv oder negativ einordnen, und einem Handlungsimpuls – dieser gibt die Richtung vor, in die wir handeln. Der wichtigste Teil scheint mir die emotionale Komponente. Aber auch die kognitive Komponente ist nicht zu unterschätzen: Fehlendes Wissen führt zu vereinfachten positiven oder negativen Interpretationen; so werden Einstellungen schnell zu Vorurteilen und Stereotypen.
Theorie und Realität stimmen nicht überein
In Dänemark stimmten beispielsweise in einer Befragung alle zu, dass Menschen mit Behinderung die gleichen Chancen erhalten sollten wie Menschen ohne Behinderung. 80% aller Schülerinnen und Schüler gaben an, dass Kinder mit und ohne Behinderung gleich behandelt werden sollen. Der tatsächliche Alltag spricht aber eine andere Sprache: 77% der Menschen ohne Behinderung haben einen Arbeitsplatz – bei Menschen mit Behinderung liegt die Quote zwischen 27% und 67%, und zwar unabhängig von Bildungsabschluss, dafür abhängig von Invaliditätsgrad. Fazit: Egal welchen Bildungsabschluss man betrachtet – Unter Menschen mit Behinderung ist die Beschäftigungsquote geringer.
Einstellungen erklären die Differenz
Was ist der Grund? Die Einstellungen zum Thema Arbeitsmarkt zeigen deutlich: 21% der Befragten möchten „lieber nicht“ / „keinesfalls“ eine Person mit Sehbehinderung als Kollegin oder Kollegen und 6% möchten „lieber nicht“ / „keinesfalls“ eine Person mit zerebraler Lähmung als Kollegin oder Kollegen.
In den Schulen fallen die Einstellungen noch dramatischer aus: 57% der Schülerinnen und Schüler nicht neben einer Person mit zerebraler Lähmung sitzen wollen. 51% würden nicht gerne neben einer blinden Person sitzen, 70% gaben an, es sei peinlich, in der Öffentlichkeit mit einer blinden Person gesehen zu werden.
Das dänische Bildungsministerium wollte mit einer Bildungsinitiative diese Einstellungen verändern, aber die Auswirkungen waren begrenzt: Die Zustimmung zu Einstellungen wie „Neben einem behinderten Schüler sitzen“ oder „Peinliches Gesehen werden in der Öffentlichkeit“ verbesserte sich nur um wenige Prozentpunkte.
Was braucht es auf Seiten der Schüler?
Es ist bekannt, dass die Inklusion bei manchen Arten von Behinderung leichter gelingt als bei anderen. Inklusion von Rollstuhlfahrern ist erfolgreicher als diejenige von autistischen Kindern. Es ist anzunehmen, dass es mentale und persönliche Voraussetzungen auf Seiten der Schülerinnen und Schüler braucht, um Inklusion gelingen zu lassen.
- Es braucht Bindungsfähigkeit, also die Fähigkeit, mit anderen Menschen in lang andauernde und emotional ausgeglichene Beziehungen zu treten
- Es braucht Impulskontrolle, also die bewusste und erwünschte Steuerung der eigenen Gefühle und Affekte
- Es braucht die Bereitschaft zum Perspektivenwechsel, also die Fähigkeit, Emotionen, Intention und Motive anderer Menschen zu verstehen, sich auf sie einzulassen
- Nicht zuletzt braucht es die Fähigkeit, mit Frustrationen umzugehen, sich motivieren zu können und die eigenen Ziele zu verfolgen, sowie zu wählen und die Folgen der eigenen Wahl zu verstehen
Peter Rodney ist Dozent für Psychologie am Fachbereich Sonderpädagogik der Dänischen Pädagogischen Hochschule in Aarhus.
Dieser Text ist eine leicht geänderte Fassung des gleichlautenden Artikels in horus 1 / 2016. Mit freundlicher Genehmigung des Autors veröffentlicht.