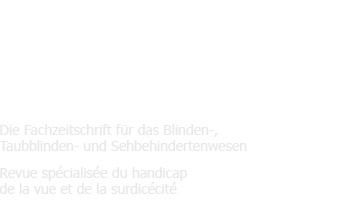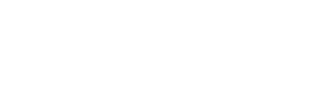„Der Weg nach der Demenzdiagnose ist überhaupt nicht klar“
Ein Interview mit Dr. Stefanie Becker, Geschäftsleiterin der Schweizerischen Alzheimervereinigung
von Ann-Katrin Gässlein
Frau Dr. Becker, Sie sind Expertin für alle Fragen, die sich um Demenzerkrankungen drehen. Wie sind Sie zu diesem Thema gekommen?
Als Gerontologin habe ich einige Jahre im Bereich der angewandten Forschung gearbeitet. Dabei bildete die Frage, wie Menschen im fortgeschrittenen Stadium der Demenz Emotionen ausdrücken. Das Ergebnis: Die Emotionen von Menschen mit Demenzerkrankung sind sehr wohl situationsgebunden. Wenn sich jemand ärgert, wenn er aggressiv reagiert, dann ist das kein Zufall, sondern hat immer einen Grund. Sein Ausdrucksverhalten in Mimik und Gestik ist sehr aussagekräftigt – aber ist vor allem nonverbales Verhalten, das man erkennen muss. Und das hat mich sehr fasziniert.
Gute Lebensqualität für Menschen mit Demenz würde dann heissen, dass das Umfeld dieser Menschen die Emotionen richtig erkennt und darauf reagiert?
Das Umfeld müsste angemessen reagieren und so gestalten sein, dass die Kranken im Rahmen ihrer Möglichkeiten in der selbstständigen Alltagsgestaltung unterstützt werden. Zu Hause, aber auch in der Pflege. Doch Architektur ist das eine, das soziale Umfeld das andere.
Ist eine Demenzerkrankung nicht für Angehörige extrem belastend?
Pro Erkranktem sind mindestens zwei bis drei weitere Personen im engeren Umfeld betroffen – sei es durch Betreuungsleistung oder die Organisation des Alltags. Am Anfang ist die Situation für die Angehörigen schwer, wenn noch keine Diagnose vorliegt. Sie können dann die Situation kaum einschätzen und richtig beurteilen.
Diese entsteht durch das unverständliche Verhalten der Erkrankten?
Die erkrankten Menschen haben häufig recht gute Strategien, um die Defizite, die durch die Demenz entstehen, zu kaschieren und zu überspielen. Das führt zum Beispiel dazu, dass Angehörige beschuldigt werden, Dinge getan oder unterlassen zu haben.
Im Verlauf der Erkrankung wird die Beziehungsebene aber immer wieder stark belastet. Wenn Partner nicht mehr als solche erkannt werden, Kinder nicht mehr als Kinder wahrgenommen werden. Das wird sehr belastend empfunden und damit muss man erst einmal umgehen lernen. Wenn das Verhalten dann „einen Namen“ also eine Diagnose hat, führt das oft zu Erleichterung. Man weiss, woran man ist und kann sich entsprechend einstellen und vorbereiten. Leider haben Angehörige viel zu selten Unterstützung.
Wo gäbe es denn Unterstützung für Angehörige?
Bei den Selbsthilfe-Gruppen für Angehörige, bei Beratungstelefonen der Alzheimervereinigung und ihren kantonalen Sektionen oder auch in therapeutischen Angeboten. Ein grundsätzliches Problem ist aber, wie die Versorgungsfinanzierung geregelt ist: In der Schweiz ist die Betreuungsleistung – die am Anfang bis zum mittleren Stadium der Erkrankung so wichtig ist – nicht finanziert. Diese bleibt Privatsache und bei den Angehörigen hängen.
Ein wichtiges Stichwort ist Demenzabklärung: Wie geschieht das heute – im Vergleich zu früher?
Vor dreissig Jahren hat man Demenz noch gar nicht richtig gekannt. Man sprach von Verwirrtheitssymptomen, hirnorganischen Psychosyndromen im Kontext der Pflegedokumentation. Auch eine wirkliche Demenzabklärung gab es kaum. Heute sind wir Welten weiter. Es werden bildgebende Verfahren eingesetzt – MRT zum Beispiel, aber auch feinere biochemische Methoden zur Früherkennung können eingesetzt werden. Dabei wird auf Biomarker zurückgegriffen, was aktuell vor allem unter ethischen Gesichtspunkten diskutiert wird, und – wie alles im Leben – zwei Seiten hat. Wie früh sollen solche Marker festgestellt und der Person mitgeteilt werden? Wer will schon 30 Jahre früher hören, dass er oder sie an möglicherweise an Demenz erkranken wird? Aber solches Wissen kann relevant sein, um seinen Lebensstil anzupassen und Risiken zu minimieren. Damit kann der Beginn der Erkrankung hinausgezögert werden.
Ist es nicht auch deshalb ein schwieriges Thema, weil es keine Heilungsmöglichkeiten gibt?
Therapien bzw. Heilung gibt es heute nicht, aber Behandlungsmöglichkeiten. Die Frühdiagnostik ist wichtig, sobald man das Gefühl hat, dass über den Zeitraum von sechs Monaten etwas nicht stimmt. Bei anderen Krankheiten zögert man auch nicht ewig, bis man zum Arzt geht. Je früher die Diagnose gestellt wird, desto mehr kann man im Hinblick auf die Krankheitsverzögerung unternehmen. Vor allem aber kann man das Umfeld besser auf diese Situation vorbereiten. Das ist ein sehr wichtiger Faktor für Lebensqualität!
Was folgt danach?
Was soll eine Person genau machen, wenn sie den Befund erfährt: „Sie haben Demenz“? Wer mit der Diagnose einer Hörsehbeeinträchtigung von einer Klinik nach Hause kommt, kann einen Ergotherapeuten aufsuchen, Hilfsmittel testen, sich schulen lassen. Auch wenn keine hundertprozentige Rehabilitation mehr möglich ist, ist doch der Weg klar. Bei Demenz ist das nicht der Fall: Es gibt keine standardisierte, selbstverständliche Begleitung von Erkrankten und Angehörigen nach der Diagnosestellung. Sie sind häufig alleingelassen.
Welche Elemente müsste eine gute Begleitung beinhalten?
Beide Gruppen – die Erkrankten und die Angehörigen – müssen gute Beratung erhalten: Welche Möglichkeiten gibt es, die Lebensführung zu unterstützen, welche Entlastungen stehen für Angehörige zur Verfügung, auch eine therapeutische Begleitung kann nötig sein. Die Diagnose Demenz ist trotz der Erleichterung zu wissen, womit man es zu tun hat, oft ein Schock. Es braucht Informationen zur Erkrankung: Was meint „Leben mit Demenz“? Die meisten Angehörigen wissen nur, was in den Medien auftaucht, und das ist Schreckensbild. Man weiss zu wenig darüber, dass auch ein gutes Leben mit Demenz möglich ist.
Vermittlung und Koordination der Informationen ist sehr wichtig. Der Markt ist zunehmend undurchsichtig. Es gibt sehr viele Angebote, aber kann die seriösen von den weniger guten kaum unterscheiden. Bei der Alzheimervereinigung gibt es seriöse und gute Informationen, die auch individuell relevant sind. Denn nicht jeder braucht alles.
Besten Dank für das Gespräch!