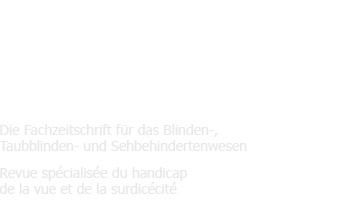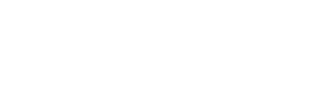Eine Kurzgeschichte der Brailleschrift

von Roger Cosaney*
Vor zweihundert Jahren revolutionierte eine Erfindung die Welt still und leise: die Brailleschrift. Dieses ertastbare Punktschriftsystem wurde von einem jungen, nach einem Unfall erblindeten Franzosen erfunden und ermöglichte Millionen von Menschen in der ganzen Welt den Zugang zu Bildung und Selbstbestimmung. Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums dieser genialen Erfindung werfen wir einen Blick auf die faszinierende Geschichte eines Alphabets, das das Leben von Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung veränderte.
Dieses Jahr feiern wir das 200-jährige Jubiläum der Brailleschrift. Dieses Alphabet besteht aus geprägten Punkten, die mit den Fingerspitzen ertastet werden können, und so Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung die Teilhabe an Bildung und Kultur ermöglicht. Wie kam es zu dieser genialen Erfindung?
Mit der Eröffnung der weltweit ersten Blindenschule im Jahr 1784 legte Valentin Haüy den Grundstein für diese effiziente Kommunikationsform, die 40 Jahre später entwickelt werden sollte. Die Vision von Valentin Haüy bestand darin, herkömmliche Buchstaben in Relief zu drucken, damit blinde Menschen lesen können. Die Entzifferung erwies sich indes als schwierig.
1809 kam Louis Braille in Coupvray, einem kleinen Dorf rund 40 Kilometer östlich von Paris, zur Welt. Als Junge erlitt er in der Werkstatt seines Vaters – einem Handwerker, der Lederwaren herstellte und dazu scharfe Werkzeuge benutzte – einen Unfall und er verlor dabei sein Augenlicht.
Als Louis mit sieben Jahren in die Dorfschule eingeschult wurde, zeigte sich schon bald, dass er ein fleissiger und sehr kluger Schüler war. Nachdem sein Vater von einer Schule für blinde Kinder in Paris erfahren hatte, schickte er seinen Sohn 1819 dorthin.
Zu dieser Zeit entwickelte Charles Barbier de La Serre, ein Hauptmann in der französischen Armee, eine Geheimschrift mit geprägten Punkten, damit Soldaten nachts kommunizieren konnten. Diese Erfindung ist Brailles Idee, die Linien von Buchstaben durch Punkte zu ersetzen, nicht unähnlich. Das System von Barbier de La Serre, bekannt als Sonographie oder Nachtschrift, besteht aus 12 Punkten, die sämtliche Laute der französischen Sprache darstellen. Sie sind in zwei Spalten à je 6 Punkten aufgeteilt. Barbier de La Serre war überzeugt, dass sein System für Blinde nützlich sein würde und stellte es deshalb 1821 am Königlichen Institut für blinde Kinder und Jugendliche vor. Louis Braille interessierte sich sehr für diese Erfindung, stellte aber ihren praktischen Nutzen in Frage und versuchte deshalb unermüdlich, diese zu verbessern. Rasch sah er ein, dass 12 Punkte mit der Fingerspitze nicht ohne vertikale Fingerbewegung erfühlt werden können. Überdies war es unbefriedigend, nicht in Einklang mit der Orthografie schreiben zu können. Aus diesem Grund halbierte Braille die Anzahl Punkte auf 6, ebenfalls in 2 Spalten à je 3 vertikal angeordneten Punkten aufgeteilt. 1825 stellte der 16-jährige junge Mann sein Alphabet seinen Kameraden und der Schulleitung vor. Pignier, der Direktor der Schule, war begeistert und ermutigte Braille, seine Erfindung weiterzuverfolgen. 1829 wurde die ertastbare Punktschrift zum ersten Mal offiziell präsentiert. Sie umfasste sämtliche Buchstaben des französischen Alphabets einschliesslich der Buchstaben mit Akzent. 1837 erschien eine zweite Publikation des Alphabets, die fortan als endgültige Version galt. Schnell kam die Brailleschrift in der Blindenschule in Paris zur Anwendung. Leider übernahm 1840 mit Dufau ein neuer Direktor das Zepter der Institution. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger stand er der Erfindung von Braille ablehnend gegenüber, weil er befürchtete, dass sich blinde Menschen von der übrigen Welt abschotten, wenn sie eine andere Schrift als die Sehenden benutzen. Nach jahrelangem Experimentieren konnten die Schüler ihren skeptischen Direktor überzeugen. Dieser musste zugeben, dass die taktile Punktschrift überlegen war. Nun stand dem Erfolg der Brailleschrift nichts mehr im Wege. Sie verbreitete sich auf der ganzen Welt. Es wurden Bücher gedruckt – zuerst in Frankreich, nach und nach auch im Ausland. Spannenderweise wurde mit der Herausgabe des Johannesevangeliums im Jahr 1860 das erste ausserhalb Frankreichs veröffentlichte Buch in Lausanne gedruckt, wohl nicht zuletzt, weil es ebenfalls auf Französisch war.
Das Alphabet von Braille wurde für die französische Sprache entwickelt. In deutsch- und englischsprachigen Ländern vermisste man den Buchstaben W. Das ist der Grund, weshalb dieser Buchstabe so unlogisch im Alphabet platziert ist. Die Vorbehalte verschwanden allmählich auch ausserhalb Frankreichs und so erhielt das neue Alphabet 1878 an einer Konferenz zur Bildung blinder Menschen offiziell den Namen „Brailleschrift“. Die USA akzeptierten das Braillealphabet erst 1932 definitiv. Es ist hauptsächlich den Anstrengungen der UNESCO zu verdanken, dass die Blindenschrift an sämtliche Sprachen in der Welt angepasst wurde, selbst an Sprachen, die ganz andere Schriftzeichen verwenden. Deshalb können heute blinde Menschen rund um den Erdball lesen und schreiben und sich so Bildung und Wissen erschliessen. Leider erlebte Louis Braille den Erfolg seiner Schrift nicht mehr. Er starb 1852 an einer Tuberkulose, an der er seit seiner Jugend litt. Wir sind Louis Braille sehr dankbar für sein wundervolles Geschenk!
*Über den Autor
Roger Cosandey engagiert sich für die Interessenvertretung von Menschen mit Behinderung. Er wurde 1944 in Le Locle geboren und arbeitete nach einer kaufmännischen Ausbildung und einem Sprachaufenthalt in England in verschiedenen Städten, bevor er sich ganz der Berufsbildung von jungen Menschen mit Sehbehinderung verschrieb. Von den 1980er-Jahren bis zu seiner Pensionierung war er als regionaler Sekretär der Westschweizer Sektion des Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverbands (sbv) tätig. Er ist bis heute aktiv im Vereinsleben – insbesondere in der Waadtländer Sektion des sbv. Fast zwanzig Jahre lang gehörte er zudem dem Gemeinderat von Lausanne an, wo er die Sozialdemokratische Partei vertrat.
Roger Cosandey war mehrere Jahre lang Mitglied der Kommission zur Weiterentwicklung der französischen Brailleschrift. Er ist dieser Schriftform bis heute tief verbunden: Für ihn ist Braille nicht nur ein Werkzeug, sondern ein Schlüssel für ein selbstbestimmtes Leben und Zugang zu Kultur. Dank der Punktschrift konnte er nicht nur Fremdsprachen erlernen, sondern auch aktiv am demokratischen Leben teilhaben. Braille steht für Roger Cosandey für intellektuelle, soziale und politische Emanzipation.
Lesetipp
Der SZBLIND gab eine Broschüre heraus über Louis Braille, der mit seiner Erfindung der taktilen Schrift das Lesen für blinde Menschen revolutionierte: Louis Braille, Erfinder der Blindenschrift. Leben und Werk.
Verfügbar unter: www.szblind.ch/infothek