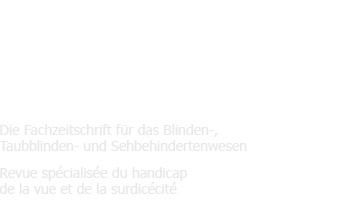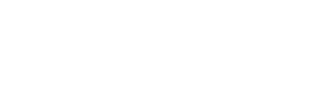Schwerpunkt Reisen: Blinder Passagier
Der Tourismusjournalist Christoph Ammann hat das Augenlicht verloren, nicht aber Kraft und Ideen, den Hindernissen des Alltags zu trotzen.
von Christoph Ammann, Reisejournalist bei Tamedia
Im Bin Yang Markt von Taipeh herrscht an diesem Morgen Hochbetrieb: Hausfrauen mit Einkaufstaschen wuseln übers Gelände, junge Männer auf Motorrollern bahnen sich hupend einen Weg. Das Hackebeil des Metzgers spaltet ungerührt Hühner, am benachbarten Stand schaufeln eifrige Angestellte Geflügelleber und -herzen in grosse Plastikgefässe. So spielt das bunte Leben auf einem asiatischen Markt. Ein gefundenes Fressen für Kameraleute und Fotografen – und für die Journalistenkollegen, die mit mir in einer kleinen Gruppe durch den taiwanesischen Markt schlendern. Doch mir helfen vor allem Gerüche und Geräusche, ein Bild des fremdartigen Schauplatzes zu formen. Manchmal mischen sich Erinnerungen ein, manchmal braucht es Phantasie. Denn auf die Optik kann ich mich nicht mehr verlassen. Ich bin blind und übe einen Beruf aus, dem ein Blinder eigentlich gar nicht gerecht werden kann: Ich bin Reisejournalist, seit 33 Jahren. 2010 trübte sich der Blick innerhalb weniger Monate, ich erblindete. Heute erkenne ich nur noch Lichtquellen.
Wie Grossvater und Vater leide ich an der Erbkrankheit Retinitis Pigmentosa. Doch im Vergleich zu den Ahnen bleibt mir ein unschätzbarer Vorteil: Die moderne Technik erlaubt es, meine Arbeit am Computer über die Ohren statt die Augen zu verrichten. Ich höre jeden Buchstaben, den ich tippe, redigiere mittels Tastenkombinationen Texte und lasse mir von der Computerstimme Notizen und Recherchematerial vorlesen. Als Leiter der Reiseredaktion von Tamedia-Zeitungen wie «SonntagsZeitung», «Tages-Anzeiger» oder «Berner Zeitung» obliegen mir Planung und Koordination der Reiseseiten. Ich briefe Freelancer, Kolleginnen und Kollegen, bearbeite deren Texte und hecke Ideen und Storylines aus. Am liebsten recherchiere ich selber Reisegeschichten. Geschätzt 50 Tage pro Jahr bin ich unterwegs. Destinationen und Reiseformen haben sich der Behinderung angepasst: Die Safari in Südafrika ergibt keinen Sinn mehr. Von Ausnahmen wie dem Trip nach Taiwan abgesehen suche ich meine Geschichten heute bevorzugt in der Schweiz und Europa. Klingt simpel, in meinem Fall bedarf jedes Projekt aber minutiöser Vorbereitung – einfach losstürmen geht nicht.
Vor Ort müssen die Partner über die Behinderung informiert werden, das Programm soll so weit wie möglich barrierefrei sein. Vor allem: ohne kundige Begleitung geht nichts. Ob bei der Inseltour auf Jersey, auf dem Nürnberger Weihnachtsmarkt oder im Ferienresort im Engadin: Ein Blinder muss sich auf sichere Assistenz verlassen können, die ihn in unbekannten Gefilden führt, die Speisekarte im Restaurant vorliest oder den Touch-Screen der Klimaanlage im Hotelzimmer bedient.
Stimmungen einfangen, Details wahrnehmen und mit wasserdichten Fakten mischen: An der Frontarbeit des Reisejournalisten hat sich aber wenig geändert. Klar, ich brauche kein Notizbuch mehr, sondern spreche meine Eindrücke heute in ein Diktiergerät, interviewe möglichst viele Gesprächspartner und Informanten. Auch bin ich im Vergleich zu früher vermehrt angewiesen auf die detailtreue Beschreibung eines kundigen Führers oder der Assistenz. Manchmal nervt es meine Begleiter ganz schön, wenn ich mich penetrant nach der Art der Fensterbögen im Dom erkundige oder die Leitfarben eines Hotels erfrage. Doch solche scheinbaren Nebensächlichkeiten schärfen im Verein mit Aussagen von Interviewpartnern und recherchierten Fakten meine Reisegeschichten.
Die häufigste Frage, die dem blinden Reisenden gestellt wird: «Haben sich deine anderen Sinne verbessert, seit du nichts mehr siehst?» Die Antwort: «Ich höre, rieche, schmecke oder fühle nicht besser als früher. Aber die Situation zwingt mich, die vier unversehrten Sinne gezielt einzusetzen.» Bin ich im Alltag allein unterwegs, orientiere ich mich zum Beispiel aufgrund des Schalles. Das Tiktak meines Blindenstockes klingt auf freiem Feld anders als in einer Häuserschlucht. Und ich achte auf Gerüche. Schliesslich riecht eine Kleiderboutique anders als eine Bäckerei. Der Luftzug verrät Strassenkreuzungen, Lücken in Häuserfronten oder Brücken. Mein weisser, verlängerter Arm tastet sich entlang von Trottoirkanten, über Kopfsteinpflaster und Treppen.
Auf Bahnhöfen und an Busstationen sind die taktilen Linien unverzichtbar für Sicherheit und Orientierung. Leider gibt es diese taktilen Helfer längst nicht überall. Gerade in weniger reichen Ländern beherrschen Löcher die Gehsteige, Abwasserkanäle sind ungedeckt, Strassenübergänge ungesichert. Seit meine visuellen Kompetenzen bei Null liegen, gebe ich mich auch nicht mehr der Selbsttäuschung und – Überschätzung hin: Wenn ich allein unterwegs bin, so lasse ich Vorsicht walten und gerate selten in wirklich heikle Situationen. Ich stolpere weniger über Stufen und Schwellen als früher, als ich noch einwandfrei zu sehen glaubte. Die Verantwortung an einen Begleiter zu delegieren, gelingt aber auch nicht immer: Kürzlich war ich zum ersten Mal mit einem Journalistenkollegen unterwegs. Er führte mich durch den Zürcher Bahnhof, wir plauderten und scherzten. Doch der Mann, der noch nie einen Blinden assistiert hatte, berechnete beim Gang auf die Rolltreppe nicht ein, dass zwei Leute mehr Platz benötigen als ein Einzelgänger. Und prompt donnerte ich mit dem Kopf gegen ein metallenes Hindernis. Blut quoll aus einer Platzwunde an der Stirn. Ich fasste mich schnell wieder, der Kollege hingegen war untröstlich und wollte vor Scham in den Boden versinken. Ich spendete ihm Trost und brachte ihn dazu, unseren gemeinsamen Ausflug fortzusetzen. Vertrauen und Mut braucht es auf beiden Seiten.