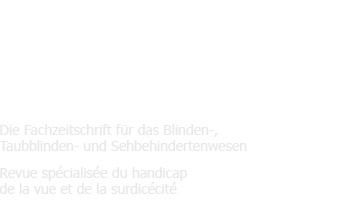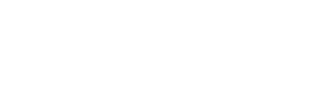Plattform: Party machen ohne Barrieren
Wieso sind Menschen mit Behinderung so selten an ihren Anlässen präsent, fragte sich das Berner Kollektiv Dachstock. Studierende der Sozialen Arbeit an der Fachhochschule Nordwestschweiz suchten nach den Gründen und gaben in einem Projektbericht Handlungsempfehlungen für ein inklusiveres Nachtleben.
Von Andrea Eschbach
Schummrige Lichtverhältnisse, eine zu hohe Theke oder einfach nur eine schlecht lesbare Getränkekarte: Das Nachtleben ist voller Hindernisse für Menschen mit Behinderungen. Das Thema „Barrierefreies Nachtleben“ beschäftigte auch seit längerem das Kollektiv Dachstock, das ein Teil des Berner Kulturzentrums Reitschule ist. Denn Menschen mit Behinderungen nutzten das Kulturangebot des Kollektivs bislang nicht oder nur sehr selten. Grund genug für eine neue Strategie des Nachtlokals. Vier Studierende der Sozialen Arbeit der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) bekamen im Rahmen ihrer Praxisausbildung im Modul «Projektwerkstatt» den Auftrag, den Status Quo zu analysieren und Handlungsempfehlungen auszusprechen. Innerhalb von sechs Monaten legten die Studierenden Salomé Cvirka, Léonie Haas, Florian Hasler und Joëlle Moser ihren Projektbericht vor. Vier Co-Forschende mit verschiedenen Behinderungsarten, darunter auch ein Teilnehmer mit starker Sehbeeinträchtigung, steuerten ihre Erfahrungen bei.
Der Dachstock pflegt bereits eine niederschwellige Willkommenskultur. Die Studierenden kamen dennoch zum Schluss, dass die Hürden im Dachstock zahlreich sind. Während zwar der Zugang zum Lokal allen Co-Forschenden zugänglich war, erweisen sich die steilen Treppen ohne kontrastreiche Markierungen als Stolperstein für Besucherinnen mit Sehbeeinträchtigungen. Für Menschen mit Sehbehinderung erweist sich nicht nur räumliche Orientierung als schwierig, auch die Bar ist nicht barrierefrei: Die Getränkekarten sind aufgrund der farblichen Gestaltung wie auch der Schriftgrösse nicht lesbar. Doch das Studierenden-Team zeigt auf, wie ein inklusives Nachtleben im Dachstock aussehen könnte. Unter anderem fordern sie eine niedrigere Tresenhöhe für Rollstuhlfahrerinnen, kontrastreiche Anstriche zur besseren räumlichen Orientierung und taktile Markierungen auf den Handläufen. Doch nicht nur räumliche Barrieren gilt es auszuräumen: „Die grössten Barrieren sind im Kopf“, sagt Salomé Cvirka. Deshalb schlagen sie und ihre Mitstreiterinnen auch Veranstaltungen mit Gebärdendolmetscherinnen oder eine „Disability-Pride-Parade“ vor. Für eine umfassende Teilhabe empfiehlt es sich gerade bei Inklusion im Musikbereich, Künstlerinnen und Künstler mit Behinderung in das Programm aufzunehmen. „Sensibilisierung findet durch Begegnung statt“, nur so können soziale Barrieren wie Berührungsängste, Vorurteile, Unverständnis durch fehlendes spezifisches Wissen, Mitleid oder Ignoranz abgebaut werden, sagt Salomé Cvirka.