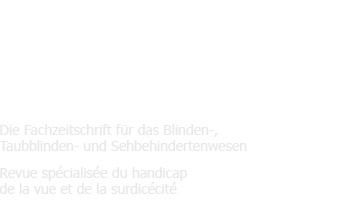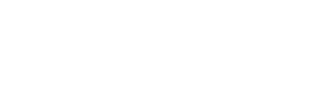«Manchmal blinkt einfach alles rot»
Perspektive aus der Sozialarbeit

Von Michel Bossart, Redaktion tactuel
Eine Hörsehbehinderung verändert das ganze Leben. Fachbereichsleiterin Sozialarbeit Astrid von Rotz erzählt, warum es nicht nur um Akzeptanz der eigenen Beeinträchtigung geht, sondern um Lebendigkeit, Selbstwert – und um Brücken, die wir alle bauen müssen.
Astrid von Rotz beschreibt Momente, in denen alles rot blinkt, so: «Man sitzt in einer fröhlichen Runde, alle reden, lachen, wechseln mühelos von einem Gespräch ins andere. Man versteht nichts mehr, fühlt sich gefangen. Vielleicht ist man ohne Begleitperson da, das bestellte Taxi kommt erst in zwei Stunden. Für jemanden mit einer Hörsehbeeinträchtigung blinken die Ampeln nur noch rot. Und plötzlich schmilzt die eigene Identität dahin. Menschen, die eigentlich selbstsicher und gesellig sind, fühlen sich auf einmal tief verunsichert und ganz allein.»
Diese Bilder begleiten sie seit vielen Jahren. Von Rotz arbeitet seit über zwei Jahrzehnten beim SZBLIND, seit 2021 leitet sie den Fachbereich Sozialarbeit der Fachstelle Hörsehbehinderung und Taubblindheit. Ihr Ziel ist es, dass solche roten Ampeln nicht das ganze Leben Betroffener dominieren. «Wenn es gelingt, die Alarmlichter abzuschwächen – von knallrot zu orange, vielleicht sogar zu grün – dann ist viel gewonnen.» Doch wie?
Akzeptanz – Zumutung oder Schlüssel?
In ihrer Arbeit begegnet sie Menschen, die sehr unterschiedlich mit ihrer Diagnose umgehen. Sie erzählt: «Einige Betroffene sagen: Verlangt von mir nicht, dass ich meine Behinderung akzeptieren soll. Das ist eine Zumutung! Andere wiederum meinen, dass das Akzeptieren der eigenen Behinderung zu 98 Prozent das Wichtigste war, um weiterzuleben. Und wiederum andere akzeptieren lediglich die medizinischen Grenzen; sie wissen, dass die Beeinträchtigung bleibt, sie akzeptieren aber die Folgen nicht und sagen: Ich werde behindert. Überall.»
Von Rotz selbst steht dem Begriff «Akzeptanz» ambivalent gegenüber. «Ich spreche lieber von der Suche nach einer neuen Lebensqualität und einem neuen Kohärenzgefühl, wo man innerlich nicht mehr so zerrissen ist. Das gelingt situationsbedingt mal besser oder schlechter. Denn Akzeptanz klingt so endgültig. Zum Vergleich: Für von Rotz ist das Gegenteil von Depression nicht das Glück, sondern Lebendigkeit. Wer lebendig bleibe, bleibe offen für Neues, könne Hilfsmittel ausprobieren, sich kreative Strategien suchen. Als Fachperson finde ich diese Vielfalt und den Austausch darüber spannend. Ich akzeptiere die Leute einfach so, wie sie sind.»
In ihrer täglichen Arbeit erlebt sie auch Momente der Erstarrung. Wenn jemand nichts mehr wagt, keine neuen Wege mehr sucht, nur noch erduldet – dann läuten bei ihr die Alarmglocken. «Das ist für mich das Zeichen, dass jemand nicht nur taubblind, sondern vielleicht auch depressiv geworden ist.» In solchen Fällen zieht sie klare Grenzen: «Als Sozialarbeiterin kann ich Beratung für rechtliche Ansprüche machen, Begleitpersonen vermitteln, die Menschen mit Fachstellen vermitteln, die interessante Angebote wie Treuhanddienste, Haushaltshilfe usw. haben. Aber wenn keine Kraft mehr da ist, wenn jede Neugier versiegt, dann müssen psychologische Fachpersonen hinzugezogen werden.»
Kämpfen, fliehen – oder lernen, zu kommunizieren
Von Rotz hörte schon mehrmals den Satz: «Ohne Assistenzpersonen fühle ich mich unter Menschen einsam. Es ist, als ob ich eine Schicht um mich hätte, die mich von den anderen trennt.» Die Fachbereichsleiterin erzählt von einem Bild, das sie gerne gebraucht, um einen Ausweg aus einer solchen Situation zu erklären: Königin Elisabeth hatte ein Täschchen, das sie auf dem Tisch – zum Beispiel – von links nach rechts verschob und gab damit ihrer Gefolgschaft ein diskretes Zeichen, dass sie den Ort verlassen wollte. Auch Menschen mit Hörsehbeeinträchtigung können sich solche Signalzeichen zulegen und müssen spüren lernen: Wann reicht es? Wann wird meine innere Ampel orange? Wie soll ich aktiv werden? Soll ich um Teilhabe kämpfen oder ist es genug für heute und ich will einfach weg? «Das ist überhaupt kein Zeichen von Schwäche, sondern eine gesunde Strategie, die sogar Königinnen anwenden», zeigt von Rotz sich überzeugt. Wichtig sei, das Selbstwertgefühl zu stärken. «Selbstwert entsteht immer mit dem Gegenüber. Man muss kommunizieren, den andern seine Lebensrealität erklären und einen gemeinsamen Umgang mit den neuen Grenzen finden» Ihr Rezept dazu: Wenn-dann-Pläne entwickeln. Wenn es zu viel wird, dann verlasse ich den Raum. Oder: Wenn ich nichts verstehe, dann frage ich direkt nach. «Das sind kleine Schritte zurück in die Selbstkontrolle.»
Schamgefühle ernst nehmen
Die Grenzen der Behinderung sind für alle spürbar. Sie rät Angehörigen in erster Linie, sich für diese zu vermittelnde Lebensrealität zu interessieren, auch über die eigenen Grenzen reden zu können, und gemeinsam Strategien zu suchen. Zum Beispiel abmachen: Was machen wir, wenn du früher als ich nach Hause willst? «Schon das kann eine Brücke bauen. Entscheidend ist, dass niemand das Gefühl bekommt, abgeschrieben zu sein.»
Und manchmal helfe es, aufkommende Schamgefühle Betroffener wirklich ernst zu nehmen. «Wenn jemand nicht mehr in der Öffentlichkeit essen möchte, weil er sich beobachtet fühlt und Angst hat, sich zu bekleckern, dann kann es eine Lösung sein, das Essen zum Beispiel im eigenen Zimmer einzunehmen. Das sind Übergänge. Keine definitiven Resignationen. Aus der entstandenen Ruhe heraus kann dann wieder etwas Neues wachsen», erklärt von Rotz.
Brücken von beiden Seiten
Von Rotz wehrt sich dagegen, dass nur von Betroffenen erwartet wird, ihre Behinderung psychisch zu akzeptieren; wir alle müssen akzeptieren, dass Normabweichungen zum Leben gehören. Sie erklärt sich mit einem weiteren Sprachbild: «Eine Brücke hält nur, wenn sie von beiden Seiten gebaut wird. Wenn nur einer baut, stürzt sie früher oder später ein.» Das heisst: Betroffene und deren Umfeld muss gleichermassen aktiv und lernbereit werden.
Ihre Teammitglieder und teilweise auch die freiwilligen Mitarbeitenden und Kommunikationsassistenten des SZBLIND gehen in die Logopädie. Sie lernen, klarer, deutlicher und «lesbarer» zu sprechen. Sie lernen auch die Gebärdensprache, Lormen und Haptik. «Das sind Anpassungen, die die Kommunikation enorm erleichtern», sagt von Rotz. Und sie weiss: Diese Haltung verändert nicht nur das Leben von Menschen mit Beeinträchtigung, sondern auch das der anderen. «Wenn wir uns bemühen, erweitern wir den Normbegriff. Der gangbare Weg wird etwas breiter. Das zu erleben, gibt uns allen den Mut, auch anderswo Ansprüche zu stellen. Mutiger zu werden, Hilfe zu fordern und anzubieten. Diese Zivilcourage ist ein tägliches Training – und wir alle können davon lernen.»
Mehr Offenheit
Astrid von Rotz blickt auf dreissig Jahre Berufserfahrung zurück. Ihr Fazit: «Ja, die Tabus sind im Vergleich zu früher kleiner geworden. Heute spricht man offener über eine Behinderung in der Familie oder im nahen Umfeld.» Zudem haben technische Entwicklungen die Lebensqualität von vielen Sinnesbehinderten stark verbessert und KI eröffnet nun weitere rasante Möglichkeiten – zum Beispiel Sprach-und Umfelderkennung. «Aber bei einer doppelten Sinnesbehinderung kommen auch diese Fortschritte schnell an ihre Grenzen, weil sich die Sinne nicht mehr ergänzen können», mahnt von Rotz. Darum brauche es nach wie vor gut geschulte Assistenzpersonen. Leider werde dieser Bedarf nicht genügend anerkannt. «Taubblinde Personen haben die Wahl, sich zeitweise todesmutig allein in der Welt zu bewegen, ohne Kommunikationsmöglichkeit mit den Menschen – wer kann schon taktile Gebärdensprache oder Lormen. Oder aber isoliert zu Hause zu bleiben. Das dürfen wir menschlich und sozialpolitisch nicht akzeptieren. Da muss auch bei uns als Gesellschaft die Ampel tiefrot blinken! Dafür setzen wir uns bei der politischen Interessenvertretung ein.»
Am Ende des Gesprächs bleibt vor allem ein Bild hängen: das der Ampeln. Um noch einmal von Rotz zu zitieren: «Es geht nicht darum, dass die Ampel nie mehr rot blinkt. Aber wenn es gelingt, aus knallrot wenigstens orange zu machen – oder sogar ein helles grün – dann wird das Leben für sehbeeinträchtigte und taubblinde Menschen – und letztendlich auch für die Gesellschaft – wieder ein Stück lebendiger.