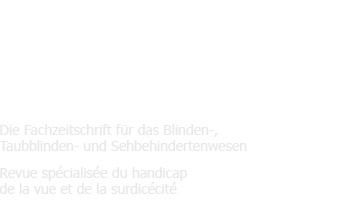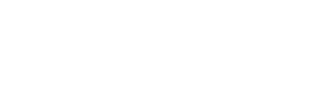Psychologische Verarbeitung einer Sehbeeinträchtigung
Perspektive aus der Psychotherapie
von Michel Bossart, Redaktion tactuel

Akzeptanz wächst nicht auf gerader Linie. Sie verläuft in Wellen: Widerstand, Trauer, Orientierung, Zuversicht – und Rückschläge. Stefan Rehmann, Psychotherapeut und selbst sehbeeinträchtigt, spricht von einem dynamischen Prozess. Entscheidend ist, Resignation zu vermeiden und Selbstwirksamkeit zu stärken.
Der Weg zur Akzeptanz der eigenen Beeinträchtigung ist kein geradliniger. Er verläuft in Wellen und Schleifen, in denen Widerstand, Trauer, Orientierung und Zuversicht immer wieder wechseln. «Es gibt kein endgültiges Bewältigtsein», erklärt Psychologe Stefan Rehmann, der selbst sehbeeinträchtigt ist. Die psychologische Fachliteratur spricht von einem dynamischen Prozess und verschiedenen Phasen der Akzeptanz einer Beeinträchtigung.
Der Beginn des Prozesses ist oft durch ein Trauma gekennzeichnet. Der Einbruch einer Erblindung oder einer gravierenden Sehbeeinträchtigung trifft die betroffenen Menschen je nach Verlauf mitten im Leben. Er kann plötzlich und unerwartet auftreten, etwa durch einen Unfall, oder sich angekündigt und erahnt entwickeln. In beiden Fällen wird das bisherige Leben radikal erschüttert. Auf das Trauma folgt die Phase von Schock und Verleugnung. Sobald der erste Schrecken überwunden ist, setzen Abwehrmechanismen ein, die dazu führen, dass die betroffenen Menschen die Realität der Erblindung beziehungsweise die Veränderung nicht wahrhaben wollen oder können. Viele klammern sich an den Gedanken, dass es sich nur um eine vorübergehende Einschränkung handle, oder hoffen auf medizinische Lösungen, die den Verlust rückgängig machen könnten. Wenn das Ausmass der Beeinträchtigung unausweichlich bewusst wird, stellen sich Trauer und Rückzug ein. Ärger, Angst, Hilflosigkeit oder Verbitterung sind häufige Reaktionen. Viele ziehen sich aus dem sozialen Leben zurück und kapseln sich emotional ab. Dieser Rückzug kann zu dauerhafter Isolation führen, wenn keine unterstützenden Kontakte bestehen. Eine besonders kritische Reaktion ist die Depression. Der Blick richtet sich dann fast ausschliesslich auf das Verlorene, auf die Fähigkeiten, die nicht mehr vorhanden sind. Das Selbstwertgefühl sinkt erheblich, und es besteht die Gefahr, dass ein depressives Syndrom über längere Zeit andauert. Diese Phase ist oft von Hoffnungslosigkeit und innerer Leere geprägt. Im weiteren Verlauf kann jedoch eine Neuorientierung einsetzen. Durch die Reflexion und Neustrukturierung früherer Lebensinhalte entsteht ein neues Selbstkonzept. Betroffene Menschen beginnen, ihre verbliebenen Möglichkeiten wahrzunehmen und neue Lebensformen zu entwickeln. Dieser Schritt markiert den Übergang von der ausschliesslichen Verlustperspektive hin zu einer vorsichtigen Öffnung für neue Wege.
Mit der Verarbeitung und Aktivierung wird die Handlungsfähigkeit wiederhergestellt. Betroffene Mensachen gewinnen ihre Energie zurück, entwickeln neue Aktivitäten und empfinden ihr Leben wieder als lebenswert. Nicht selten führt dies zu einer Phase von Überaktivität, die aus überschiessender Begeisterung entsteht oder zur Abwehr gegen noch nicht vollständig verarbeitete Gefühle dient. Manchmal ist sie auch der Versuch, sich möglichst angepasst in eine Umwelt einzufügen, die noch von Stigmatisierungen geprägt ist.
Am Ende steht die Phase der Selbstannahme und Selbstachtung. Der Mensch akzeptiert sich mit seinen positiven wie auch seinen eingeschränkten Fähigkeiten. Er ist wieder selbständiger geworden und kann sein Leben mit einer neuen Balance gestalten. Doch auch in dieser Phase sind Rückschläge möglich: Krisen oder neue Verlusterfahrungen können das fragile Gleichgewicht erneut erschüttern. Trotzdem bildet diese Stufe eine Grundlage, auf der Resilienz wachsen und ein sinnerfülltes Leben gestaltet werden kann.
Stigmatisierung schwächt Resilienz
Resilienz ist die Fähigkeit von Einzelpersonen und Gemeinschaften, schwierige Lebenssituationen wie Krisen oder Rückschläge erfolgreich zu bewältigen und sich davon zu erholen, oft sogar gestärkt daraus hervorzugehen. Resilienz hängt von vielen Faktoren ab: Persönlichkeit, Vorerfahrungen, soziale Netze und materielle Ressourcen. Rehmann erklärt: «Menschen, deren Beruf oder Freizeitaktivitäten stark visuell geprägt waren, tun sich meist schwerer, mit einer Sehbeeinträchtigung umzugehen.» Andere fänden schneller Zugang zu alternativen Strategien. Wichtig seien tragfähige Beziehungen, positive Alltagserfahrungen und die Möglichkeit, gewohnte Interessen fortführen zu können. Er meint damit: «Es geht nicht nur um «neue» Aktivitäten für Sehbeeinträchtigte wie Hörbücher hören oder das gemeinsame Tandemfahren. Hilfreicher sei es, wenn jemand zum Beispiel wieder zum Eishockeymatch geht oder nach Venedig reise – Dinge, die für die betroffene Person schon immer bedeutungsvoll und wichtig waren. Entscheidend dabei sei, dass Betroffene möglichst selbstständig handeln können, auch wenn sie Begleitung brauchen. Ebenso sind Angehörige, Freunde und Bekannte Teil dieses Prozesses – auch sie müssen lernen, den Verlust zu akzeptieren und neue Rollen zu finden.
Hinzu kommt die Auseinandersetzung mit der Stigmatisierung. Sehbeeinträchtigte Menschen werden oft auf ihre Defizite reduziert. «Die Reduktion auf das, was fehlt, verstellt den Blick auf das, was neu möglich ist», sagt Rehmann. Ein emanzipatorischer Ansatz sieht Betroffene nicht als defizitäre «Sehende», sondern als Menschen mit eigenen Standards und Kulturformen.
Bei der Resilienz spielt auch der Verlauf einer Sehbeeinträchtigung eine wichtige Rolle. Wer plötzlich erblindet, wird direkter mit einer unveränderlichen Realität konfrontiert. Bei schleichendem Verlust hingegen investieren viele lange Zeit enorme Energie, um ihre Restsehfähigkeit auszugleichen – ein Prozess, den Rehmann als besonders belastend beschreibt
Emotionen bestimmen den Prozess
All diese Zyklen bis zur Akzeptanz sind von intensiven Emotionen geprägt. «Angst kann durch die Bedrohung des Alltags entstehen, Scham durch erlebte oder vorgestellte Abwertung im sozialen Umfeld oder Trauer ist das Resultat von Verlust vertrauter Möglichkeiten», sagt Rehmann. Viele Betroffene versuchen zunächst, ihre Einschränkung zu verbergen, um nicht aufzufallen. «Das ist ein Kraftakt, der viel Energie kostet», meint Rehmann. Wird die Behinderung unausweichlich, kommt es oft zu einem sozialen Rückzug und/oder einer Art Hilflosigkeit. Rehmann fährt fort: «Gleichzeitig können aber erste Schritte zur Bewältigung gelingen: neue Routinen entstehen, erste Hilfsmittel werden erfolgreich ausprobiert und man sucht Gespräche mit Fachpersonen.»
Ob daraus dann eine Akzeptanz oder Resignation erwächst, ist entscheidend. «Resignation bedeutet ein kompletter Rückzug, Energieverlust und eine depressive Abwärtsspirale», sagt Rehmann. Akzeptanz dagegen öffne den Blick für Gestaltungsmöglichkeiten. «Bewältigungsorientierte Menschen werden fürs Vorwärtsgehen belohnt. Sie erleben so eine Selbstwertsteigerung, Rückhalt und Geborgenheit.»
Ein Schlüssel ist die Erfahrung von Selbstwirksamkeit. «Wer spürt, dass er auch unter veränderten Bedingungen handeln und Einfluss nehmen kann, gewinnt Stabilität», ist Rehmann überzeugt. Selbstwirksamkeit bedeutet hingegen nicht, alles alleine schaffen zu müssen, sondern auch, Hilfe annehmen zu können, ohne sich entmündigt zu fühlen. Hier braucht es ein unterstützendes Umfeld. Die Psychologin Eva-Maria Glofke-Schulz spricht in ihrem Buch «Löwin im Dschungel» von einem Ansatz, der nicht nur Stabilität sichert, sondern auch Persönlichkeitswachstum und gesellschaftlichen Wandel anstossen kann. Betroffene seien aktive Subjekte, die Sinn und seelisches Wachstum suchen – und so zugleich zu einem kulturellen Wertewandel beitragen. Rehmann fasst das folgendermassen zusammen: «Selbstwirksamkeit hat mit positiven Kontakten zu Menschen zu tun, von denen ich zwar teilweise abhängig bin, denen ich aber auch etwas geben kann.» Es geht also darum, das eigene Sein als Wert zu erleben und diesen Wert auch der eigenen Umwelt zugutekommen zu lassen.

Bild: SZBLIND