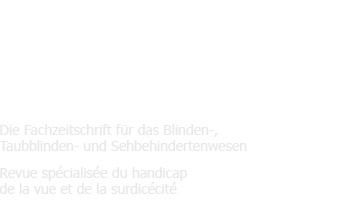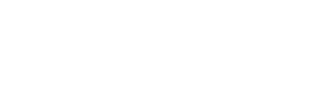Zwischen Internat und Integration
Pädagogik für blinde und sehbehinderte Kinder ist heute breit gefächert
Von Ann-Katrin Gässlein
Lange herrschte die Ansicht, dass sehbehinderte und blinde Kinder in einer Sonderschule, vorzugsweise in einem Internat, am besten aufgehoben seien. In den letzten 25 Jahren ist ein grundlegender Wechsel eingetreten. Vielfältige Formen der Sehpädagogik stehen heute gleichberechtigt nebeneinander.
Sehbehinderten und blinden Menschen fehlt – teilweise oder ganz – ein wesentlicher Sinn für die Wahrnehmung, das Handeln und die Kommunikation. Besondere Herausforderungen sind
die alltäglichen Verrichtungen: die persönliche Hygiene, das An- und Auskleiden, das Einnehmen von Nahrung. «Daneben haben sie sich den Sitten und Gebräuchen der Sehenden anzupassen, wollen sie an dieser Welt teilhaben», schreibt Marco Knecht, Heilpädagoge im Schul- und Beratungszentrum Sonnenberg Baar. Das alles «ist nur mit viel Arbeit und Zeit, Durchhaltevermögen und einer Portion Ehrgeiz erreichbar». Wenn ein Sehrest vorhanden ist, muss er gezielt genutzt werden. Gleichzeitig gilt es, das Hören und Tasten für die Kompensation zu schulen. All dies müssen blinde und sehbehinderte Kinder lernen – und zwar unabhängig von der jeweiligen Erziehungs- oder Schulform. Wie hat sich die Pädagogik in den letzten Jahren und Jahrzehnten auf diese Situation eingestellt?
Internat als Grenzerfahrung
Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts war klar: Das Internat ist die einzige Schulform für blinde Schülerinnen und Schüler. Neben dem dort gesicherten spezifi schen Unterricht schien auch die Form des Internatsbetriebs pädagogisch am sinnvollsten: Im Internat sollten «die Schüler Selbstständigkeit und Gewandtheit im Umgang mit den Menschen und Dingen erwerben», schreibt Herbert Garbe 1959 in seiner Dissertation zur Theorie der Blindenpädagogik. Für Generationen blinder und sehbehinderter Menschen stellten die Internatsschulen einen gemeinsamen Brennpunkt ihrer Geschichte dar. Eine pointierte Erfahrung beschreibt André Assimacopoulos in seinem Vorwort zum SZBLIND-Jahresbericht 2011: Die Internate waren für die Schülerinnen und Schüler Objekte der «Hassliebe» – wie alle Orte, an denen sie Fähigkeiten gelernt, aber auch Grenzen erfahren und Niederlagen einstecken mussten. Bei den Eltern, die ihr Kind dauerhaft in der Einrichtung unterbrachten, herrschte «Dankbarkeit, aber auch Eifersucht und Argwohn». Wird das Kind wirklich genug gefordert? Lernt es das, was es lernen will?
Seither hat sich vieles geändert. Während vor zehn Jahren noch klar war, dass sehbehinderte Kinder und Jugendliche in eine Sonderschule gehen, ist heute Standard, dass auch Kinder mit leichter geistiger Behinderung in die Volksschule integriert werden. Verschiedene Entwicklungen ermöglichten diesen Wandel: Erst mit den seit den 1970er Jahren aufkommenden Bildschirm- und Kopiergeräten – gefolgt von elektronischen Hilfsmitteln wie sprechende Taschenrechner, Wandtafelkameras, digitalen Diktiergeräten und vielem mehr – konnten sehbehinderte und blinde Kinder am gemeinsamen Unterricht teilnehmen. Ein zweiter Schub erfolgte Mitte der 1990er Jahre auf Druck der Elternvereinigungen: Sie bewirkten, dass sich die Rolle der Sonderschule neu defi nierte. Heute werden – ausgehend vom Wohl des Kindes und seinen spezifi schen Bedürfnissen – separate und integrative Schulungsformen als gleichwertig betrachtet. Der Sonderschullehrer oder die -lehrerin wurde zum Coach und zum Vermittler der Integration.
Vielfalt der Sehpädagogik
Sehpädagogik in der Schweiz orientiert sich heute an den individuellen Bedürfnissen blinder, sehbehinderter und sehbehindert-mehrfac hbehinderter Kinder in allen Altersstufen – was die Arbeit anspruchsvoll und komplex macht. Weit verbreitet ist die Früherziehung als eine Massnahme für Kinder ab Geburt bis in die ersten Schuljahre hinein. Wenn Eltern oder Ärzten bestimmte Auffälligkeiten in der Entwicklung eines Kindes feststellen, kommen Abklärungen, Unterstützungs- und Fördermassnahmen zum Einsatz. Früherziehung geschieht zu Hause, im familiären Umfeld. Neben der Förderung der Kinder werden auch die Eltern des sehbehinderten Kindes beraten. Nach wie vor spielt die separative Sonderschule eine wichtige Rolle: Heute besuchen Kinder und Jugendliche entweder eine Sonderschule im Regelbereich – das heisst, dass sich ihr Unterricht nach dem Lehrplan der Volksschule richtet – oder die Schule ist speziell für Kinder und Jugendliche ausgerichtet, die neben der Sehbehinderung auch eine geistige-, Lern- oder Mehrfachbehinderung haben. Auch das Internat hat keineswegs ausgedient. Als Wohnmöglichkeit in einer sonderpägagogischen Einrichtung gilt es heute als wichtig, «wenn das tägliche Pendeln für die Kinder eine zu grosse Belastung darstellt und die Eltern nicht oder nur teilweise die notwendige Betreuung oder Pfl ege zu Hause leisten können», so Christian Niederhäuser, Direktor der Stiftung für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche Zollikofen. Das Zusammenleben im betreuten Umfeld mit Gleichaltrigen und Gleichbetroffenen könne für das Lernen sozialer Verhaltensregeln sehr förderlich sein. Die Mehrheit der Kinder beansprucht heute aber die integrative Sonderschulung. Das Modell sieht vor, dass die Sonderschule das blinde oder sehbehinderte Kind, das in eine reguläre Volksschule geht, berät und unterstützt. Bei einer leichten Sehbehinderung von Kindern reicht eine ein fache Beratung aus. Regelmässig finden Low Vision Abklärungen statt, um den Stand der Sehbehinderung zu erfassen, oft auch in Kooperation mit Augenärzten und Optikern. Je nach Unterstützungsbedarf werden verschiedene Leistungsprogramme durch die Sonderschulen angeboten (Beratung, Beratung und Unterstützung, Integrative Sonderschulung). Besonders trainiert werden die Orientierung und Mobilität der Kinder, aber auch die so genannten «Lebens- praktischen Fähig keiten». Je nach Schwere der Sehbehinderung oder bei anstehender Blindheit wird auch die Punktschrift vermittelt.
hbehinderter Kinder in allen Altersstufen – was die Arbeit anspruchsvoll und komplex macht. Weit verbreitet ist die Früherziehung als eine Massnahme für Kinder ab Geburt bis in die ersten Schuljahre hinein. Wenn Eltern oder Ärzten bestimmte Auffälligkeiten in der Entwicklung eines Kindes feststellen, kommen Abklärungen, Unterstützungs- und Fördermassnahmen zum Einsatz. Früherziehung geschieht zu Hause, im familiären Umfeld. Neben der Förderung der Kinder werden auch die Eltern des sehbehinderten Kindes beraten. Nach wie vor spielt die separative Sonderschule eine wichtige Rolle: Heute besuchen Kinder und Jugendliche entweder eine Sonderschule im Regelbereich – das heisst, dass sich ihr Unterricht nach dem Lehrplan der Volksschule richtet – oder die Schule ist speziell für Kinder und Jugendliche ausgerichtet, die neben der Sehbehinderung auch eine geistige-, Lern- oder Mehrfachbehinderung haben. Auch das Internat hat keineswegs ausgedient. Als Wohnmöglichkeit in einer sonderpägagogischen Einrichtung gilt es heute als wichtig, «wenn das tägliche Pendeln für die Kinder eine zu grosse Belastung darstellt und die Eltern nicht oder nur teilweise die notwendige Betreuung oder Pfl ege zu Hause leisten können», so Christian Niederhäuser, Direktor der Stiftung für blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche Zollikofen. Das Zusammenleben im betreuten Umfeld mit Gleichaltrigen und Gleichbetroffenen könne für das Lernen sozialer Verhaltensregeln sehr förderlich sein. Die Mehrheit der Kinder beansprucht heute aber die integrative Sonderschulung. Das Modell sieht vor, dass die Sonderschule das blinde oder sehbehinderte Kind, das in eine reguläre Volksschule geht, berät und unterstützt. Bei einer leichten Sehbehinderung von Kindern reicht eine ein fache Beratung aus. Regelmässig finden Low Vision Abklärungen statt, um den Stand der Sehbehinderung zu erfassen, oft auch in Kooperation mit Augenärzten und Optikern. Je nach Unterstützungsbedarf werden verschiedene Leistungsprogramme durch die Sonderschulen angeboten (Beratung, Beratung und Unterstützung, Integrative Sonderschulung). Besonders trainiert werden die Orientierung und Mobilität der Kinder, aber auch die so genannten «Lebens- praktischen Fähig keiten». Je nach Schwere der Sehbehinderung oder bei anstehender Blindheit wird auch die Punktschrift vermittelt.
Schwierigkeiten und Erfolgsfaktoren
Nicht immer funktioniert das Zusammenspiel von Elternhaus, Regel- und Sonderschule reibungslos: «Die integrative Sonderschulung beruht auf einem labilen Gleichgewicht», sagt Marco Knecht. Labil deshalb, weil nicht immer alle Akteure gleichzeitig gleich viel beitragen können. In der Phase der Vorbereitung, aber auch während der Schulzeit muss das Gleichgewicht stets neu beurteilt werden. Marco Knecht: «Tabus darf es keine geben. Auch der Abbruch der integrativen Sonderschulung muss denkbar und möglich sein». Eine Checkliste hilft, Faktoren abzuklären, die förderlich für die Eingliederung des sehbehinderten Kindes in die Regelschule sind. Dienlich ist, wenn das Kind einen Wortschatz für die Interaktion mit der Lehrperson und anderen Kindern mitbringt, wenn es auf andere Kinder hört und sich helfen lässt, Anweisungen befolgt – und in der Hygiene, der Handhabung seiner Kleider und in der Ernährung weitgehend autonom ist. Auf Seiten der Eltern ist es wichtig, dass diese die Behinderung ihres Kindes anerkennen – und nicht durch die integrative Schulung vertuschen wollen. Sie sollen auch abwägen, dass beide Schulformen Vor- und Nachteile haben: Neben den zahlreichen positiven Aspekten heisst Integration in die Volksschule eben auch, dass die Hauptlehrperson weniger für die Sehproblematik des Kindes sensibilisiert ist und dass das Kind im Durchschnitt in der Volksschule ein bis zwei Lektionen pro Woche blindenspezifischen Unterricht erhält – während es in einer Sonderschule ständig sehbehindertenspezifisch geschult wird.

Low Vision-Abklärung, Orientierung und Mobilität und Lebenspraktische Fähigkeiten gehören zum Programm heutiger Sonderschulpädagogen.
Förderliche Faktoren sind natürlich auch auf Seiten der Schule zu verorten: Die Integration eines sehbehinderten Kindes in die Regelklasse ist Angelegenheit des Schulteams, nicht einer einzelnen Lehrperson. Eine heterogene Klasse ist erfahrungsgemäss besser geeignet, um ein behindertes Kind aufzunehmen – die Klassengrösse hingegen ist zweitrangig. Und nicht zuletzt müssen Schulleitung wie Klassenlehrperson Interesse am Thema Behinderung mitbringen, keine Angst vor Überforderung haben und aus eigener Überzeugung zu dem Vorhaben Ja sagen.