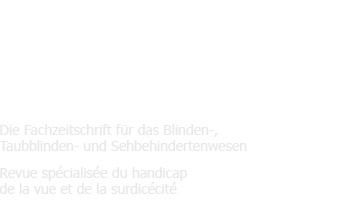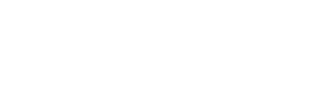„Die Selbstdefinition geschieht über ein vermeintliches Defizit“
Ein Interview mit den Psychotherapeuten Stefan Rehmann
Herr Rehmann, was geschieht auf psychologischer Ebene, wenn Menschen sehbehindert oder blind werden?

Fachpersonen müssen sich auf die Bewältigungsmuster ihrer Klienten einstellen: Wie gehen diese mit der Sehbehinderung um?
Bild: kurzschuss, SZBLIND
Mit dem Blind-Werden verändert sich das Selbstbild eines Menschen, und zwar einschneidend. Blindheit und Sehbehinderung sind in unserer Gesellschaft vorwiegend negativ konnotiert. Eine „Spezialität“ wird zur Hypothek. Dann kommen Gedanken wie: „Andere haben bessere Chancen als ich.“ Oder „Ich befinde mich in einer Minderheit.“ Die Selbstdefinition geschieht über ein vermeintliches Defizit, und man ist schnell geneigt, alle Schwierigkeiten auf diese auffälligste Besonderheit zu schieben.
Zu was führen solche Gedanken?
Gefährlich ist, dass eine Spirale in Gang gesetzt wird. Ausgangspunkt kann eine einzelne schlechte Erfahrung sein – wenn man zum Beispiel im Sportunterricht in der Schule bei der Bildung von Mannschaften immer als Letzter gewählt wird. Daraus resultiert eine sinkende Selbstwertung. Man entwickelt Phantasien und Zukunftsängste, und dann sinkt eben auch die Ausdrucksfähigkeit. Die Phantasien schlagen sich auf den nonverbalen Ausdruck der Körpersprache nieder. Die gefürchtete Phantasie wird mit der Zeit Realität: Man wird immer unsicherer, hofft, dass die anderen es nicht wahrnehmen, was sie aber natürlich doch tun – so entsteht ein Teufelskreis.
Welche psychologischen Mechanismen gibt es vor allem bei sehbehinderten Kindern?
Jedes Kind lernt, seine Talente einzusetzen, um seine wichtigsten Bedürfnisse zu befriedigen. Dazu zählen Wertschätzung, Rückhalt, Liebe, aber auch Kontrollerfahrungen. Wenn das persönliche Repertoire des Kindes ausreicht, um diese Ziele zu erreichen, dann besteht nur ein kleines Risiko, pathologische Strukturen zu entwickeln, also psychisch krank oder sehr auffällig zu werden. Wenn ein Kind seine Bedürfnisse aber nicht befriedigen kann, entwickelt es häufig alternative Strategien, die auch selbstschädigend sein können. Ein dysfunktionales Muster ist zum Beispiel die Strategie, über Laut-Sein Aufmerksamkeit zu erregen, wobei man eigentlich Zärtlichkeit will (aber nicht bekommt). Bei Kindern mit Sehbehinderung gibt es oft ein schwindendes Vertrauen in die eigenen Ressourcen und Talente. Sie fragen: „Was kann ich bieten, damit man mich liebenswert findet?“
Und was geschieht bei Erwachsenen, die sehbehindert werden?
Bei erwachsenen Menschen ändert sich mit einer Sehbehinderung, wie sie die Umwelt erleben. Konkret fühlt sich die physische Welt anders an, je nachdem ob man mit Stock unterwegs ist oder die Orientierung in Blickdistanz behält. Der Alltag selbst besteht vor allem aus Bewältigungsstrategien und hohen Anpassungsleistungen. Wenn diese gelingen, kann ein neues Selbstwertgefühl resultieren. Blind-Sein wird dann als „Anders-Sein“ verstanden, als Spezialität. Sicher immer noch verbunden mit Verlusten – wenn man beispielsweise nicht mehr Autofahren kann – aber im Grunde nimmt man die Auseinandersetzung mit dem Alter vorweg: Älterwerden ist immer mit zunehmenden Einschränkungen verbunden; die allerletzte Einschränkung ist dann der Tod.
Sie arbeiten als Psychologe und Psychotherapeut sowohl mit Betroffenen als auch mit Fachpersonen im Sehbehindertenwesen. Was ist für Fachpersonen wichtig?
Sie müssen vor allem gut informiert sein, wie ihre Klientinnen und Klienten mit ihrer Sehbehinderung oder Blindheit umgehen: misstrauisch, ablehnend oder vorsichtig? Daran schliesst sich die Frage an, wie sie die Menschen motivieren, mit ihrer Sehbehinderung besser umzugehen – vor allem hinsichtlich der Mobilität oder im Umgang mit Hilfsmitteln.
Welche Haltungen treffen Fachpersonen bei sehbehinderten oder blinden Menschen?
Ein Muster, das auftreten kann, ist das übermässige Misstrauen. Ihm zugrunde liegt die Schwierigkeit, Hilfe von anderen Menschen anzunehmen. Vielleicht war die zentrale Motivation immer: „Nur nicht von irgendjemandem abhängig sein!“ Dann wird man blind und wehrt sich zunächst gegen alle Hilfeleistungen. Geht das nicht mehr, nimmt man die Hilfe gezwungenermassen an, aber bleibt innerlich aversiv. Und da die Sehbehinderung immer auch Auswirkungen auf die Interaktion hat, wird diese Aversion spürbar. Das heisst, der Fachperson, die unterstützen will und auch unterstützen muss, schlägt im Gespräch Misstrauen entgegen. Diese ist nicht persönlich gegen die einzelne Lehrperson gerichtet, sondern resultiert aus der psychischen Disposition der sehbehinderten Person. Trotzdem kann leicht der Eindruck entstehen: „Der hat was gegen mich – oder gegen Menschen generell.“
Andere Menschen mit Sehbehinderung gehören zu den „vermeidenden Typen“: Sie haben möglicherweise schon Verletzungen erlebt und machen in der Kommunikation einfach „zu“. Dann wird es schwierig, sie zu erreichen und zu motivieren. Für Fachpersonen ein Problem, denn es beeinträchtigt nicht nur die Beziehungsqualität, sondern auch den Erfolg ihrer eigenen Arbeit.
Sind Misstrauen und Vorsicht als Haltung bei sehbehinderten Menschen sehr verbreitet?
Grundsätzlich ist die Beziehungsgestaltung mit sehbehinderten Menschen nicht anders als mit sehenden. Was mir aber auffällt: Blinde und sehbehinderte Menschen sind mehrheitlich äusserst angepasst und konfliktvermeidend. Sie wissen, dass sie irgendwann in irgendeiner Weise Hilfe brauchen und vermeiden es daher, ihre Mitmenschen vor den Kopf zu stossen. Auch gerade wenn sie gerne mal sagen würden: „Nein danke, diese Hilfe brauche und will ich jetzt nicht!“
Was ist ein grosses Problem bei fortschreitender Sehbehinderung?
Der Kampf oder Widerstand gegen eine zunehmende Sehbehinderung oder Blind-Werden kostet einfach zu viel Energie. Man will den Rest seiner Sehfähigkeit maximal ausnutzen. Immer steckt man halb in einer Alarmstimmung: Wie viel sehe ich heute? Dabei läuft man Gefahr, die anderen Sinne zu vernachlässigen. Auch der lange Verzicht auf einen Stock ist so ein „Energiefresser“. Wenn man den Einsatz lange hinauszögert, weil man ja keine Dynamik einbüssen will, fehlt viel Kraft für andere Tätigkeiten.
Was ist typisch für die Augenkrankheit „Glaukom“?
Das Glaukom zeichnet sich durch Unberechenbarkeit aus. Die Sehfähigkeit hängt von den Licht- und Wetterverhältnissen ab, die Menschen stets anders wahrnehmen. Das ist schwer kommunizierbar. Die Umgebung denkt: Mal sieht er, mal wieder nicht! Auch für die betroffene Person ist der nicht-konstante Verlauf der Sehbehinderung erschöpfend.
Wie sieht eine Psychotherapie in der Regel aus?
Die Therapie sieht vor allem vor, „Nischen“ zu finden, um die Alltagsbewältigung zu fördern. Es geht darum, das soziale Umfeld zu sichern, Kontrollmöglichkeiten zu eröffnen und Rückhalt und Geborgenheit zu vermitteln. Es geht eigentlich immer darum: Wie kann ich damit umgehen, dass ich nicht weiss, was andere Menschen von mir sehen? Wie lerne ich, zu akzeptieren, dass ich nicht mehr alles in der Hand habe? Und was bedeutet das für mein Bedürfnis nach persönlicher Sicherheit?
Herzlichen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Ann-Katrin Gässlein